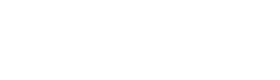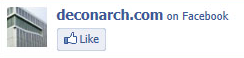„Haben die Dinge von sich aus Bedeutung oder kann Bedeutung immer nur gegeben werden?“ INTERVIEW mit Martin Brüger
Ein KĂĽhlschrank an der Wand? Ein Toaster ohne Schlitze? Ein Haushaltsgerät – aber was war das doch gleich? Ganz alltägliche Gegenstände begegnen uns in den Objekten und Installationen von Martin BrĂĽger, vertraut und fremd, befremdend zugleich, aber ebenso ĂĽberraschend und verblĂĽffend: Die Titel der Objekte, „Gorenje”, „Tefal”, „AEG” etwa, verweisen darauf, dass da etwas zu sehen ist, das wir kennen – mit einer gehörigen Portion Augenzwinkern.Â
Durch erstaunlich simple Eingriffe – die Reduktion auf charakteristische Formelemente ebenso wie die geschickte Auswahl und Ergänzung der isolierten Bestandteile – gelingen dem Künstler Arbeiten, die dem Betrachter ungewohnt gewohnte Ansichten eröffnen. Es handelt sich um ausrangierte Kühlschranktüren, Teile von Haushaltsgeräten oder Möbelstücken, die vom Sperrmüll, von Flohmärkten, aus Internetauktionen oder von Recyclingbetrieben stammen. Brüger arbeitet mit Dingen und Materialien, die er nicht selbst produziert hat und die nicht aus dem Kunstkontext stammen. Industrieprodukte, wie sie den häuslichen Alltag prägen. Diese werden mit selbstgebauten Erweiterungen aus hochglanzlackiertem MDF kombiniert, die den ursprünglichen formalen und funktionalen Kontext bewusst außer Kraft setzen.
Häufig installiert er diese FundstĂĽcke und seine daraus erarbeiteten Objekte auch in ortsspezifischen räumlichen Inszenierungen, wie sie etwa gerade in seiner Ausstellung „turbo“ in der Berliner Galerie Rasche Ripken zu sehen sind. Auch diese (Innen-)Räume greifen vertraute Elemente auf, die verfremdet werden – wenn Tische und Kommoden nicht vor der Wand stehen, sondern buchstäblich in ihr, wenn StĂĽhle und Sessel so gedrängt stehen, dass sie die einladenden Sitzgelegenheiten ad absurdum fĂĽhren.
In Fotoarbeiten wiederum beschäftigt sich BrĂĽger unter anderem mit Fassadengliederungen urbaner und industrieller Architektur. Auch sie interessieren in ihren vertrauten Ansichten, als zweidimensionale Flächenerscheinung. Die Aufnahmen sind meist frontal, ausschnitthaft und bei bedecktem Himmel gemacht, so dass es keine Licht- und Schattenpartien, keine Plastizität gibt. So werden die architektonischen Flächen neu definiert und „die Unscheinbarkeiten des Alltags in ein Licht gerĂĽckt, das das Entdecken des Unbekannten im Bekannten ins Bewusstsein rĂĽckt”, wie BrĂĽger sagt.

Geräteobjekte v. l. n. r.: Tefal 3, 2010, Tefal 2, 2010, Tefal 1, 2008, jeweils 28 x 22 x 22 cm Ober- und Unterteil einer gebrauchten Joghurtmaschine incl. Anschlusskabel; Lampe leuchtet beim Einschalten; keine weitere elektrische Funktion; Mittelteil aus gefrästem, hochglanzlackiertem MDF.
Es ist das Bekannte und Vertaute, das man in seiner Alltäglichkeit und „Dauerpräsenz” nicht mehr wahrnimmt, das den KĂĽnstler interessiert, dem er nachspĂĽrt und das er in oft verblĂĽffender Weise gewissermaĂźen ans Licht holt.
In einem ausfĂĽhrlichen Austausch mit deconarch.com hat Martin BrĂĽger Einblick in seine Ăśberlegungen und Arbeitsprämissen gegeben. Im Interview verrät er, wie er Dinge und ihre Bedeutung hinterfragt, was gerade die Kunst leisten kann im Hinblick auf das Schärfen der Wahrnehmung im Alltäglichen und was hinter seinem „Museumsblick” steckt.
all illus. (c) Martin BrĂĽger
INTERVIEW
Grundlage Ihrer Arbeit sind architektonische Räume und Gegenstände, denen wir im Alltag ganz selbstverständlich begegnen. Wie kam es zu der Beschäftigung damit?
Ich denke, wie wohl jeder Künstler beschäftige ich mich mit dem Existenzbereich, in dem ich mich bewege, und in diesem Feld richte ich meine Aufmerksamkeit ganz besonders auf die materiellen Schöpfungen des Menschen, die ja alle Ausdruck seiner conditio humana sind. Die Dingwelt, die wir geschaffen haben, und die Art und Weise, wie wir auf sie reagieren, nehme ich als abstrahiertes Spiegelbild wahr, als Reflexion menschlichen Seins. Und je genauer man versucht, die Selbstverständlichkeit und Sicherheit unserer alltäglichen Wahrnehmungsprämisse zu analysieren – dass nämlich das Sein von Dingen mit dem übereinstimmt, wofür wir sie halten, wie wir sie wahrnehmen –, desto mehr gerät genau das ins Wanken. Da wird es nicht nur aus künstlerischer Sicht spannend. Die gewohnte Verlässlichkeit von banalen, alltäglichen Dingen zu dekonstruieren macht mir großen Spaß, weil durch diese Erzeugung von Störfeldern möglicherweise Mechanismen ans Tageslicht kommen, wie wir durch unsere Anschauung unsere Welt kreieren.
Ganz alltägliche Gegenstände wie Kühlschränke, Küchengeräte, aber auch Putzlappen begegnen wir in Ihren Arbeiten verfremdet, erkennbar zwar, aber doch verblüffend anders – und dies durch oft ganz einfache Eingriffe. Der Titel weist darauf hin, was zu sehen ist, ein Kühlschrank von Bosch etwa oder von Gorenje, das Objekt selbst ist aber auf ungewohnte Ausschnitte reduziert.

Tefal 1, 28 x 22 x 22 cm, 2008
Ober- und Unterteil einer gebrauchten Joghurtmaschine incl. Anschlusskabel; Lampe leuchtet beim Einschalten;
keine weitere elektrische Funktion; Mittelteil aus gefrästem, hochglanzlackiertem MDF.
Ich bin von Natur aus jemand, der gerne ganz genau hinschaut, der Lust hat herauszufinden, wie etwas funktioniert, und der dem ersten Anschein oft misstraut. Mich zieht das Unbekannte im Bekannten an und so untersuche ich die Dinge, denen ich im Alltag begegne. Wie verändern sich die Dinge, wenn ich sie auf den Kopf stelle, Kontexte verdrehe, meinen Blickwinkel verrenke?
Fast noch aufregender und vor allen Dingen unendlich ergebnisreicher als die Frage, was die Dinge sind und wie sie funktionieren, bleibt die Frage, was die Dinge nicht sind und wie sie nicht funktionieren. Ich habe schon als Kind mit großer Begeisterung kaputte Radios auseinandergenommen, um zu schauen, wo genau denn die Musik herkommt, habe mich dann aber auch gerne in der Vielzahl bunter Bauelemente verloren, deren Bedeutung mir unbekannt war. Da ich nicht wusste, welche Funktion sie hatten, konnte ich für sie jede nur erdenkliche Funktion erfinden. Gerade treibe ich mich für eine neue Serie von subversiven Auto-Objekten staunend im Autozubehör- und Tuninghandel herum, wo ich wunderbar absurde Teile entdecke, bei denen es nicht mehr um Funktion, sondern nur noch um Repräsentation geht. In so einem Chromsportauspuff ist die Selbstironie schon auf wunderbare Weise mit eingebaut.
Sie sprechen auch von einem „Museumsblick“, mit dem Sie diesen Alltagsgegenständen begegnen.

Berliner Zimmer, Galerie RASCHE RIPKEN BERLIN, 2010, gebrauchte Berliner Möbel, Teppichboden, in L-förmige Galeriewand integriert.
Wenn ich in eine Kunstausstellung gehe, schalte ich meine Wahrnehmungsfähigkeit und mein Reflexionsvermögen auf Maximum. Ich versuche einen möglichst offenen, weiten Geist zu haben, der neugierig ist, sich auf unerwartete Dinge einzulassen. Ich lege erst einmal das Bedürfnis beiseite, im Unbekannten möglichst schnell die Spur des Bekannten zu entdecken, um zu sehen, was da wirklich ist, unabhängig von meinen Erwartungen und Projektionen. Man könnte sagen, das ist ein vorbegriffliches Sehen. In der Psychoanalyse spricht man von „freischwebender Aufmerksamkeit“. Dabei handelt es sich um einen völlig offenen, nicht bewertenden, erwartungsfreien und möglichst projektionsfreien Bewusstseinszustand des Analytikers, in dem sich ohne Einschränkungen alles ereignen darf, was jemand anderes äußert. Erst danach setzt dann eine Reflexion ein, die sich zugesteht, den neuen Eindruck mit bekannten Werten abzugleichen und zu beurteilen.
Irgendwann habe ich entdeckt, dass sich das Erleben der Alltagswelt ganz stark verändert, wenn ich ihr mit genau diesem „Museumsblick“ begegne. Wenn alles, was ich sehe, erst einmal freie Form sein darf, ohne dass ich ihr gleich die Begriffe überstülpe, die ich dafür habe, und wenn ich erst einmal die Erfahrung, die ich mit demselben oder einem ähnlichen Ding gemacht habe, und überhaupt die ganzen mentalen Konzepte, die ich in Relation zu meiner Umwelt pflege, beiseite lasse, dann wird das Betrachten einer Hausfassade zu einem ähnlich ergreifenden Erlebnis, wie das Betrachten eines Bildwerkes im Kunstkontext.
In fast allen meinen Arbeiten habe ich als Ausgangspunkt Dinge und Materialien benutzt, die ich nicht selbst produziert habe, die nicht aus dem Kunstkontext stammen. Industrieprodukte, Massenwaren. Da kommt im künstlerischen Prozess unter anderem das Prinzip des Readymades zum Tragen, das einen Bedeutungswandel von Gegenständen erzeugt, indem Nicht-Kunstgegenstände ihrem Herkunfts- und Funktionskontext entzogen werden und im Kunstkontext neu definiert werden. Die Möglichkeit der freien Neudefinition von architektonischen Formen in meinen Fotoarbeiten, ist für mich eine faszinierende Möglichkeit, die Unscheinbarkeiten des Alltags in ein Licht zu rücken, das das Entdecken des Unbekannten im Bekannten ins Bewusstsein rückt.
Können Sie uns diese „Neudefinition von architektonischen Formen“ etwas näher erläutern? Mit Architekturformen beschäftigen Sie sich vor allem in Fotoarbeiten.
In meinen Fotoarbeiten beschäftige ich mich unter anderem mit Fassadengliederungen urbaner und industrieller Architektur, die mich in diesem Kontext als zweidimensionale Flächenerscheinung interessiert, losgelöst vom dreidimensionalen Baukörper. Die Aufnahmen sind meistens frontal, ausschnitthaft und bei bedecktem Himmel gemacht, so dass es keine Licht- und Schattenpartien gibt, die die Plastizität des Motivs betonen. Dieser Abstraktionsprozess führt zu ganz ähnlichen Bildergebnissen, wie sie die Künstler der Minimal Art, des Konstruktivismus und der Konkreten Kunst auf ganz anderem Wege geschaffen haben. Während sie sich auf die Autonomie der selbst erzeugten Form berufen, die auf nichts anderes verweist als sich selbst, verfolge ich einen kontextualistischen Ansatz: Einerseits ist jedes Ding natürlich ein Produkt komplexer Ursachen und momentaner Wechselwirkungen, andererseits können wir es nicht unabhängig von unseren interpretativen individuellen Wahrnehmungsmodalitäten erfahren.
Prinzipien wie Serialität, Rhythmik und Modularität treten im 20. Jahrhundert in ähnlicher Form parallel und sich gegenseitig beeinflussend in Kunst, Architektur und Design auf. Wie diese Disziplinen einen gemeinsamen Formenpool schaffen und alle sich daraus frei bedienen, ist für mich ein faszinierendes Phänomen, da das gleiche Formelement in den unterschiedlichen Anwendungsbereichen verwendet wird, aber immer etwas anders definiert wird. Eindrücklich war für mich da zum Beispiel Ende der 1990er Jahre die zufällige Entdeckung eines Gebäudes in Frankfurt, dessen Fassade sich aus Metallprofilen und farbig hintermalten Glasscheiben zusammensetzte. Diese Gestaltung hatte eine zwar etwas fragwürdige, aber trotzdem bestürzende Ähnlichkeit mit den bekannten abstrakten Bildern von Mondrian.
Auch hier werden gerade die „alltäglichen“ Gebäude zum Thema in Ihren Arbeiten.
Auf der Suche nach Fotomotiven interessieren mich weniger die herausragenden Bauten. Es zieht mich nicht so sehr die vielbeachtete High End-Architektur an, sondern weit mehr die durchschnittliche, überall präsente „Trivialarchitektur“. Gerade weil sie uns ständig und unaufdringlich umgibt, wird sie zur großen Unbekannten, da wir meist automatisch dazu neigen, die scheinbar vertrauten Dinge im Alltag als hinreichend bekannt, weder gewinnbringend noch gefährlich, und somit als irrelevant einzuordnen.
In Ihren Installationen wiederum kreieren Sie selbst Räume aus oft im Grunde bekannten „Bestandteilen“, die aber „irgendwie anders“ sind.

Auf schwankendem Boden, Kunstverein Grafschaft Bentheim, Neuenhaus, Kunstverein Ingolstadt, 2009
begehbare Röhre 237 x 227 x 610 cm aus Holz, lackiertem MDF, gebrauchten Möbeln
Das ist im Kern der gleiche Mechanismus, wie ich ihn eben im Bezug auf meine Fotoarbeiten beschrieben habe. Ich bediene mich aus dem großen Pool alltäglicher Materialien und Gegenstände, die alle mit einer kollektiv akzeptierten Bedeutung aufgeladen sind, und stelle diese in den Installationen in fremde Kontexte. Diese Redefinition von Funktionszusammenhängen führt die ursprüngliche Bedeutung der Ausgangsmaterialien ein Stück weit ad absurdum und öffnet einen Freiraum für neue Bedeutungen. Die Frage, die damit verbunden ist, wäre: Haben die Dinge von sich aus Bedeutung oder kann Bedeutung immer nur gegeben werden? Bei meiner Installation „Auf schwankendem Boden“ stellt sich zum Beispiel die Frage: Ist ein Stuhl, der an der Decke montiert ist und auf dem ich nicht sitzen kann, überhaupt noch ein Stuhl? Und der ringsherum möblierte Raum, der ins Wanken gerät, sobald ich ihn betrete, gibt mir auch nicht mehr die Sicherheit, wie ich sie von einem Zimmer erwarte. Dass die eingesetzten Bestandteile in meinen Installationen, wie Sie sagen, „irgendwie anders“ sind als gewohnt, kann beim Besucher eine Irritation auslösen, die enge Gewohnheitsmuster im Bezug auf unsere Wahrnehmungsfilter, Denk- und Handlungsmuster aufbrechen kann. Und das ist wiederum ein Vorteil von Rauminstallationen, die bei mir ja oft begehbar oder benutzbar sind: Man tritt körperlich in ein Werk ein, ist von ihm umgeben und man spürt dessen Präsenz sehr direkt auf einer körperlichen Ebene. Das hat natürlich eine andere Intensität als eine Fotografie, in die man nur mental „einsteigen“ kann.
Das Spiel mit dem Erkennen und der Wahrnehmung – und der Irritation derselben – spielt eine zentrale Rolle. Wie finden Sie Motive und Themen?
Ich schaue ganz viel, ich versuche meine Sinne ganz weit zu öffnen und ich versuche zu verfolgen, was mein Geist mit diesen EindrĂĽcken macht, wie er sie verarbeitet. Ich bin ĂĽberaus fasziniert von der Welt der Wahrnehmungsfehler, der mentalen Fehlleistungen, falschen VerknĂĽpfungen und Fehlinterpretationen, weshalb ich in meinen Arbeiten auch gerne Fährten lege, die zu falschen Schlussfolgerungen fĂĽhren. Wobei man sich dann wiederum selbst ertappen kann … Solche Fehlleistungen können einem oft mehr Hinweise darauf geben, wie der Geist funktioniert, als wenn alles in gewohnten Bahnen läuft.
Manchmal laufe ich durch die Stadt und versuche dabei, meine Aufmerksamkeit vom zentralen Blickfeld in die Augenwinkel zu verlagern. Das müssen Sie mal probieren. Sie werden merken, dass dadurch ein ganz anderes Sehen stattfindet, in dem die üblichen Selektionsmuster nicht mehr richtig greifen und einem plötzlich Dinge auffallen, die uns keinerlei Aufmerksamkeit entlocken könnten, wenn wir sie direkt anschauen.
Ihre Frage, wie ich Motive und Themen finde, beinhaltet schon ein Stück weit die Antwort: Ich finde sie. Gerade das erste Motiv einer Fotoserie oder der erste Ausgangsgegenstand einer Objektserie. Ideen zu Rauminstallationen ergeben sich meistens auch erst in der direkten Auseinandersetzung mit den räumlichen und inhaltlichen Gegebenheiten eines Ausstellungsortes. Ich laufe durch eine Straße und plötzlich fällt mir unerwartet eine Fassadenstruktur oder ein Detail davon ins Auge.
Das war z.B. 2003 der Beginn einer neuen Objektserie mit Kühlschranktüren, als ich eines Morgens auf der Suche nach Frühstückszutaten meinen Kühlschrank zu Hause öffnete und die Innenseite der Tür unvermutet mit jenem „Museumsblick“ anschaute, den ich oben schon beschrieben habe. Plötzlich war die Nahrung nicht mehr im Fokus meiner Aufmerksamkeit, auch nicht der Kühlschrank in seiner Funktion als Kühlschrank, sondern die konstruktive Form der Türinnenseite mit ihren unterschiedlich großen Fächern, Ablagen, Klappen und Halterungen. Die mutierten in meinem inneren Auge zu Fassadenelementen eines Plattenbaus mit Balkons, Fenstern und Geländern. Wenige Tage darauf schraubte ich bei einem auf der Straße stehenden ausrangierten Kühlschrank die Türe ab und nahm sie mit ins Atelier. So wie mein Blick die Türe meines eigenen Kühlschrankes mental aus ihrem gewohnten Funktionskontext herausgelöst hatte, so trennte ich danach physisch die Tür vom funktionsgebenden Kühlkörper ab.

AEG 2 (links), AEG 3 (rechts), je 28 x 22,5 x 16 cm, 2010, Unterteil von gebrauchten Joghurtmaschinen incl. Anschlusskabel; Lampe leuchtet beim Einschalten;
keine weitere elektrische Funktion; Oberteil aus gefrästem, hochglanzlackiertem MDF
Um diesen Herauslösungs- und Abstraktionsprozess zu einer autonomen und gleichzeitig offeneren Form hin zu verstärken, entwickelte ich im Atelier dann noch die Idee der Rahmenform, in die die Tür eingepasst werden sollte. Diese vom Kontext des Ausgangsgegenstandes relativ unabhängige „Zutat“ fügt dem Werk einen neuen Kommentar dazu, der über den Readymade-Gedanken hinaus weist.
Sie arbeiten sowohl mit Fotografie als auch mit Objekten und Rauminstallationen. Welche Möglichkeiten eröffnet das jeweilige Medium?
Ich bin kein Künstler, der auf bestimmte Materialien, Techniken oder Medien festgelegt ist. Mir geht es um Inhalte, die sich durch verschiedene Materialien und Medien in unterschiedlichen Facetten beleuchten lassen. Vielleicht könnte man ganz grob sagen, die Fotografie zeigt mehr, mit welchem Blick ich der Welt begegne, während die Objekte und Installationen stärker meinen physischen Umgang mit ihr betonen. Wie gesagt, ich liebe das Demontieren und Rekombinieren von Dingen. Die Fotografie hat dabei den Vorteil großer Leichtigkeit, sie ist ephemerer, während der bildhauerische Prozess mit seinem körperlichen Eingreifen ins Material lustvoller sein kann und im Ergebnis manifester ist. Aber eigentlich sind es nur unterschiedliche Methoden, die um die gleiche Inhaltlichkeit kreisen. Außerdem werden meine fotografischen Werke in den meisten Fällen noch manuell nachbearbeitet, ich schneide Teile heraus und ersetze sie durch andere Materialien. Das ist im Prinzip derselbe Vorgang wie bei den Objekten.
„Die Welt ist, wie ich sie sehe“: Sie arbeiten in Ihren Werken auch darauf hin, zu erkennen, dass Dinge immer nur das sind, wofür wir sie halten. Damit widersprechen Sie ja der eher gängigen Sicht – dem Wunsch?! –, dass mehr hinter den Dingen ist, als man wahrnimmt.

Das Mannheimer Zimmer, Kunsthalle Mannheim, 2004, gebrauchte Möbelstücke, Tapete, Echogerät, Raum 6,25 x 2,50 x 2,50 m
Ja, ja, wir sind permanent bestrebt, uns selbst die eigene Seinskontinuität und die Kontinuität unserer Umwelt zu versichern, um nicht haltlos durch die Existenz zu treiben. Wir wollen immer noch an das „Ding an sich“ glauben, wie Kant dies zum ersten Mal bezeichnet (und auch schon negiert) hat. An die Existenz von Objekten mit immanenten Eigenschaften und Seinsweisen, unabhängig vom betrachtenden Subjekt. Nach dem Motto: Wenn alles andere in seiner Wirklichkeit so ist, wie ich es erfahre, dann kann ich mir auch meiner eigenen Existenz sicher sein. Das ist natürlich ein verständlicher Wunsch, wie Sie es schon angedeutet haben, aber bei genauerer Betrachtung lässt sich diese Annahme leicht wiederlegen. Welche Mittel stehen uns denn zu Verfügung, um die Dinge zu erfassen, um sie in ihrer Seinsweise zu verstehen?
Es sind unsere Sinne, die uns WahrnehmungseindrĂĽcke liefern, und unser Verstand, der diese EindrĂĽcke verarbeitet, interpretiert und benennt. Erkennen und Verstehen ist ein mentaler Modus, bei dem die „Rohdaten“, die unsere Sinne und unser Denken uns liefern, abgeglichen werden mit dem Fundus unserer bisherigen Erfahrung und deren Interpretation. Kommt es dabei zu einer Kongruenz oder einer annähernden Deckungsgleichheit zwischen aktuellem Eindruck und Erinnerung, findet Erkennen und Benennen statt. Und damit beginnt auch schon die Projektion des Bildes, das wir uns von einem Ding gemacht haben – einschlieĂźlich unserer Erwartung und Schlussfolgerungen – zurĂĽck auf das Objekt. Ein Neugeborenes, dessen Erfahrungsspeicher noch relativ leer ist, hat auch nur sehr begrenzte Fähigkeiten zum Erkennen. Welche Bestehensweise ein Ding unabhängig von unserer Betrachtungsweise hat, entzieht sich völlig unserer Erfahrung, denn wir haben wirklich nur unsere individuelle Wahrnehmungsebene zu VerfĂĽgung, um mit einem Ding in Kontakt zu treten.

„FREIRAUM oder Schützt die Illusion der Freiheit vor der Erkenntnis des Gefangenseins in der Illusion der Freiheit?“, Mannheimer Kunstverein, 2012, 973 x 786 cm, Höhe 212 cm
Dass sinnliche Erfahrungen und deren Interpretationen bei Menschen sehr verschieden bis gegensätzlich sein können, haben wir zu Genüge erlebt. Es gibt auch keinerlei objektive Vergleichsmöglichkeit, ob zwei Menschen wirklich absolut das Gleiche „sehen“, wenn sie das Gleiche anschauen. Sobald wir uns von einem Objekt als getrennt erfahren, nehmen wir unser Sein als verschieden vom Sein des Objekts wahr. Wir nehmen eine Außenperspektive ein und erkennen nur das, was unserem begrenzten Wahrnehmungs- und Erkenntnisspielraum entspricht. Wir können die Welt um uns herum einfach nicht aus ihrer eigenen Perspektive heraus betrachten, und selbst das würde uns kein absolutes, unveränderbares Bild geben. Da muss man nur daran denken, wie unterschiedlich unsere Selbstwahrnehmung in unterschiedlichen Situationen ist. Dass dieses simplifizierte und fragmentierte Bild von einem wahrgenommenen Objekt nicht unbedingt viel mit dem Objekt selbst zu tun haben muss, liegt auf der Hand.
Nun kann man natürlich einwenden, dass die Existenz eines „Dinges an sich“ auch nicht die Bestätigung unserer Wahrnehmung braucht, um zu sein. Braucht sie natürlich nicht, aber wir können darüber dann auch keinerlei Aussage treffen. Genau diese Verwechslung des Eindruckes, den ein Objekt in uns auslöst, mit dem von uns unabhängigen Sein des Objektes ist für mich bei vielen meiner Arbeiten Ausgangspunkt für die Verwirrspiele, die ich in Ansichten (Fotoarbeiten) und Gegenstände (Objekte) einschleuse. Eine subtile dekonstruierende Infiltration in unser alltägliches Erleben, die vielleicht für einen Moment das aufscheinen lässt, was Kant mit Subjektivismus bezeichnet hat. Das Ding als Spiegel unserer Vorstellung davon.
Gibt es (neben Kant) philosophische Konzepte, mit denen Sie sich auseinandersetzen und die sie in Ihren Ăśberlegungen beeinflussen?

Extensions, Galerie der Stadt Backnang, 25.11.2005 – 22.1.2006, Gotischer Chor, Höhe ca. 12 m, 4 rote Kunststoffrutschen (GFK), Höhe 2,88 m, Länge 4,60 m
Vor jeder philosophischen Betrachtung steht bei mir immer erst einmal die möglichst genaue und achtsame Wahrnehmung eines Gegenstandes, sowie die Selbstbeobachtung meiner eigenen Funktionsweise. Wie läuft meine Wahrnehmung ab, was macht mein Bewusstsein mit den Eindrücken des gegenwärtigen Erlebens? Wie kommt es zum Erkennen? Wie und in welchem Maß vermischt sich Erinnerung, Erwartung, Bewertung und Benennung im Bild, das ich von einem Gegenstand habe, mit dem Sein des Gegenstandes? Wie funktioniert meine mentale Projektion zurück auf das Wahrnehmungsobjekt?
Ich habe schon Kant erwähnt, den ich erstaunlicherweise aber gerade erst neu entdecke. Bei seiner „transzendentalen Ästhetik und Analytik“ finde ich viele Korrespondenzen zu meinem Denken. Die empirische Vorgehensweise und die daraus entwickelten Theorien von Vertretern des sogenannten „Radikalen Konstruktivismus“, Kognitionswissenschaftler und Neurobiologen wie Francisco J. Varela, Humberto R. Maturana und Ernst von Glasersfeld haben mich stark geprägt. Sie kommen zu dem Schluss, dass alles Wissen, wie immer man es auch definieren mag, nur im Bewusstsein von Menschen existiert und dass das denkende Subjekt sein Wissen nur auf der Grundlage eigener Erfahrung konstruieren kann. Das führt in letzter Konsequenz zu einer radikalen Dekonstruktion jeglicher Objektivität von Sein. Auf der anderen Seite setzt dies auch einen enormen (künstlerischen) Handlungsspielraum frei.
Gibt es noch weitere Inspirationen?

Jet Foto, 87 x 120 cm, 2010, Farbfotografie hinter Acrylglas, Foto teilweise entfernt, hinter den Leerflächen semitransparentes Acrylglas
Nur kurz erwähnt, große gedankliche Anregungen habe ich auch von indischen Philosophen des 7. Jahrhunderts erfahren. Nagarjuna und Chandrakirti, die in gewisser Weise auch die Urväter der „Radikalen Konstruktivisten“ des 20. Jahrhunderts sind.
Welche Möglichkeiten bietet die künstlerische Arbeit vor diesem Denkhintergrund? Oder anders gefragt: Warum Kunst?
Kunst gehört zu den ganz wenigen menschlichen Betätigungsfeldern, denen erst einmal keinerlei inhaltliche Beschränkung auferlegt ist, seit sie sich Anfang des letzten Jahrhunderts von der Vorgabe der Abbildhaftigkeit befreit hat. Sie kann sich frei mit allem auseinandersetzen, was erfahren, gedacht und mitgeteilt werden kann. Sie kann sich in jeden Kontext hineinbegeben, dort recherchieren und der eigenen Weltsicht eine individuelle Ausdrucksform verleihen. Kunst ist von ihrer Natur her ergebnisoffen und prozesshaft. Da finden Experimente statt, die nicht unbedingt dazu dienen, vorher festgelegte Thesen und Erwartungen zu bestätigen, sondern in ihr steht ein Erfahrungsraum zu Verfügung, in dem sich auch die Eigendynamik des Ungeahnten, Unberechenbaren und Unsystematischen entfalten kann. Kunst gibt die Chance, der eigenen Neugier völlig freien Lauf zu lassen, über alles frei nachzudenken und dabei die Gundprämissen des eigenen Denkens ebenfalls frei festzulegen. Sie muss nicht funktionieren, sie kann einfach sein, subjektiv, provokant, alles hinterfragend. Nicht dass ein Perspektivenwechsel prinzipiell immer gewinnbringend sein muss, aber die Chance steigt, dass man mehr über ein Ding erfährt, wenn man es – angestoßen durch den anderen Blickwinkel eines Kunstwerkes – „irgendwie anders“ als gewöhnlich betrachtet.
Und zu guter Letzt: Natürlich hat ein Künstler auch eine ganze Menge nicht immer nur angenehme Arbeiten zu erledigen, aber der eigentliche schöpferische Prozess, der Moment, in dem Idee und Form zusammenfinden, hat etwas absolut Freudvolles.
Martin BrĂĽger, haben Sie herzlichen Dank fĂĽr diese intensiven Einblicke in Ihre Arbeit!